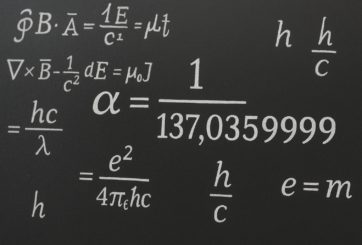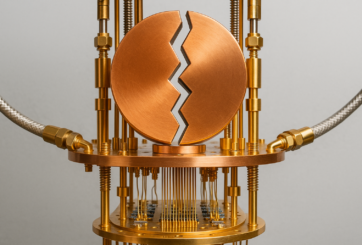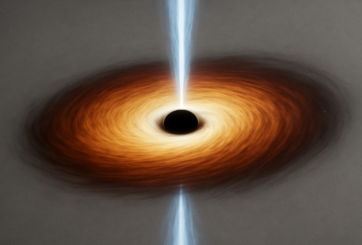Schematische Darstellung eines ultrakurzen Lichtpulses, der in der Faser in Solitonen aufbricht.
Quelle: IPHT Jena
Aus einem ultraschnellen intensiven Laserpuls, den sie in die Faser einkoppeln, erzeugen die Wissenschaftler ein, für das menschliche Auge nicht sichtbares, sehr breites Lichtspektrum im nahen bis mittleren Infrarotbereich (1,1 bis 2,7 µm).
Aufgrund der besonderen Eigenschaften des flüssigen Faserkerns, bricht der Lichtpuls in eine Vielzahl von Lichtwellen verschiedener Wellenlänge, den Solitonen, auf. Sie bilden das extrem breitbandige Laserlicht, das als Superkontinuum-Lichtquelle für Anwendungen in der medizinischen Bildgebung, Messtechnik und Spektroskopie unverzichtbar ist.
Kohlenstoffdisulfid zeigt nicht-lineare optische Effekte und hohe Transmission
Der eingekoppelte Lichtpuls bricht in der optischen Faser nur dann in Solitonen auf, wenn er nicht-linear mit Materie wechselwirkt. Im Fall der Flüssigkernfasern bedeutet dies, dass sich die optische Dichte der Flüssigkeit im Kern stark mit der Intensität des eingestrahlten Lichts ändert. Nur wenige Materialien zeigen nicht-lineare optische Effekte und besitzen gleichzeitig eine gute Lichtdurchlässigkeit im Infrarotbereich.
Mario Chemnitz, Mitarbeiter am Leibniz-IPHT und Erstautor der Veröffentlichung, erklärt den ungewöhnlichen Effekt: „Im Faserkern befindet sich Kohlenstoffdisulfid, eine flüssige chemische Verbindung, die das Licht sehr stark bricht. Strahlen wir nun polarisiertes Laserlicht ein, richten sich die Kohlenstoffdisulfid-Moleküle im elektromagnetischen Feld des Lichts aus. Durch diese molekulare Orientierung hängt die optische Dichte und damit die Lichtausbreitung in der Faser von der Intensität des Laserlichts ab.“
Optischer Memory-Effekt
Eine Besonderheit bei Kohlenstoffdisulfid ist, dass sich die Moleküle mit einer bestimmten Zeitverzögerung ausrichten. Ist der eingestrahlte Laserlichtpuls viel kürzer als die Zeit, die die Moleküle zur Orientierung im optischen Feld benötigen, beobachten die Wissenschaftler eine besondere, verzögerte Dynamik der entstehenden Solitonen. Sie wurde bereits im Jahr 2010 vorhergesagt, doch erst jetzt gelang den Jenaer Forschern der experimentelle Nachweis und die exakte theoretische Beschreibung der Prozesse.
Mario Chemnitz beschreibt das Phänomen als einen optischen „Memory-Effekt“ der Flüssigkeit. Diese einzigartige Eigenschaft der Flüssigkernfasern sorgt dafür, dass die spektrale Bandbreite des in den Fasern erzeugten Lichts weniger fluktuiert. Damit bilden sie eine stabilere Alternative zu bisher bekannten breitbandigen Lichtquellen, die auf optischen Fasern aus Spezialgläsern basieren.
Die Originalveröffentlichung mit dem Titel “Hybrid soliton dynamics in liquid-core fibres” von Mario Chemnitz, Martin Gebhardt, Christian Gaida, Fabian Stutzki, Jens Kobelke, Jens Limpert, Andreas Tünnermann und Markus A. Schmidt erschien in Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-017-00033-5
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00033-5.epdf
http://www.leibniz-ipht.de