Junge Mathematik-Professorin erhält europäischen Preis

Die Mathematikerin Olga Holtz wurde auf dem 5. Kongress der Europäischen Mathematiker Gesellschaft (EMS) in Amsterdam mit dem EMS-Preis ausgezeichnet.
Mit dem Preis ehrt die EMS junge Mathematikerinnen und Mathematiker für herausragende Leistungen. Die 34-jährige Professorin lehrt und forscht seit 2007 an der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich mit der Frage, wie Computer schneller und zuverlässiger mit riesigen Datenmengen rechnen können.
„Es ist eine große Ehre für mich, zusammen mit hervorragenden jungen Mathematikern ausgezeichnet zu werden. Und es freut mich sehr, dass meine interdisziplinäre Forschung Anerkennung findet. Allen meinen Kollegen in Berlin und den USA bin ich sehr dankbar für die wunderbare Zusammenarbeit“, sagt die Preisträgerin. Die EMS zeichnet Olga Holtz für ihre Erkenntnisse auf dem Gebiet der theoretischen Informatik aus, die in den nächsten Jahren die Computerberechnung grundlegend verändern könnten, und erkennt an, dass sie die Grenzen zwischen angewandter und reiner Mathematik stets überschritten hat. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert.
„Mit Olga Holtz haben wir eine junge Mathematikerin in Berlin, auf die wir mächtig stolz sind. Wir haben auf Basis des DFG-Forschungszentrums MATHEON und der BERLIN MATHEMATICAL SCHOOL exzellente Forscherinnen und Forscher aus aller Welt nach Berlin geholt – Olga Holtz war eine von ihnen. Nun hoffen wir, dass sie bleibt und ihre Arbeitsgruppe – ihre eigene 'Schule' – an der TU Berlin ausbaut“, sagt Günter M. Ziegler, Professor am Institut für Mathematik und Initiator des laufenden Jahres der Mathematik.
Ein Spezialgebiet der jungen Mathematik-Professorin ist die numerische lineare Algebra. Hier beschäftigt sie sich unter anderem mit der Frage, wie viele Rechenoperationen man braucht, um große Matrizen zu multiplizieren. Das ist ein grundlegendes, ungelöstes Problem der Mathematik, das Olga Holtz mit Methoden der Gruppentheorie angeht. Gleichzeitig ist es ein Forschungsgebiet mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei der Wetter- und Klimasimulation.
Olga Holtz wurde 1973 in der russischen Stadt Tscheljabinsk geboren.
Nach dem Mathematikstudium ging sie in die USA und schloss dort im Jahr 2000 ihre Promotion ab. Anschließend kam sie mit einem Humboldt-Stipendium zum ersten Mal nach Berlin. Danach wurde sie an die Universität Berkeley berufen. Für ihre Forschungsleistungen erhält sie 2006 den Sofja Kovalevskaja-Preis der Alexander von Humboldt-Stiftung für Spitzennachwuchsforscher und ist seitdem Professorin für Mathematik an der TU Berlin. Am 5. Juli wurde Olga Holtz in die Junge Akademie aufgenommen, einer Nachwuchsorganisation der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.
Mehr Informationen erteilt Ihnen:
Thomas Vogt, Redaktionsbüro Jahr der Mathematik an der TU Berlin,
Tel.: 314-78788, E-Mail: vogt@math.tu-berlin.de
Media Contact
Alle Nachrichten aus der Kategorie: Förderungen Preise
Neueste Beiträge
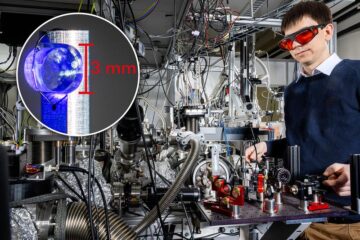
Atomkern mit Laserlicht angeregt
Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt
Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern
Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…





















