Molekulare Krebsdiagnostik – Leipziger Forscher spüren wandernde Krebszellen auf

Die Technik eigne sich zum Beispiel, um nach einer Therapie den Behandlungserfolg zu überprüfen und verbliebene Krebszellen ausfindig zu machen, erklären die Forscher um den Leipziger Kinderonkologen Professor Dr. med. Holger Christiansen im Fachblatt „The Journal of Clinical Investigation“.
Dadurch ließen sich möglicherweise Rückfälle durch Tochtergeschwülste wesentlich früher erkennen. Zudem sei es prinzipiell möglich, das Verfahren auf andere Tumorarten wie Brust- oder Darmkrebs zu übertragen.
Krebszellen, die sich im Körper auf Wanderschaft begeben, können unter Umständen die gefürchteten Metastasen hervorrufen. Mit der „Amplicon-Fusion-Site-PCR“ genannten Technik ist es möglich, solche Zellen zu finden. „Wir können damit prüfen, ob zum Beispiel nach der operativen Entfernung des Primärtumors, noch Krebszellen im Körper verblieben sind“, erklärt Dr. med. Axel Weber, Mitarbeiter des Forschungslabors in der Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie, und Hämostaseologie am Universitätsklinikum Leipzig.
Die neue Methode beruht auf der Tatsache, dass Krebszellen sich in ihrem Erbgut von gesunden Körperzellen unterscheiden. Dadurch lassen sie sich mit Hilfe der Molekulargenetik auch unter Millionen anderer Zellen ausfindig machen.
Um den Krebszellen auf die Spur zu kommen, identifizieren die Wissenschaftler – ausgehend von Gewebeproben des Ursprungstumors – zunächst typische Bereiche im Erbgut der Krebszellen. Anschließend ermitteln sie die genaue Gensequenz an den Grenzbereichen dieser so genannten „amplifizierten genomischen Regionen“ (ampGRs). Diese kommen nur in Tumorzellen, nicht aber in gesunden Körperzellen vor. Auf dieser Basis nutzen sie die so genannte Polymerasekettenreaktion (PCR), um in Gewebeproben, zum Beispiel im Blut, im Knochenmark oder im Lymphgewebe nach Krebszellen zu suchen. Denn mit der PCR lassen sich gezielt bekannte Gensequenzen vervielfältigen und sichtbar machen.
Ist das Krebs-eigene Erbgut in einer Gewebeprobe vorhanden, fällt der PCR-Test positiv aus: Ein sicherer Hinweis auf das Vorhandensein von Krebszellen. Sind nur „normale“ Zellen im untersuchten Material fällt der PCR Test negativ aus.
Für ihre Arbeit hatten die Forscher Tumormaterial von Kindern mit so genannten Neuroblastomen verwendet. Dabei handelt es sich um einen Nervenzelltumor, der meist in der frühen Kindheit auftritt. Von drei der 40 untersuchten Kinder lagen den Wissenschaftlern auch Blut- und Knochenmarkproben zur Untersuchung vor. In allen drei Fällen konnten mittels der Tumorzell-spezifischen PCR Krebszellen in den Verlaufsproben nachgewiesen und somit wichtige Hinweise darüber erhalten werden, wie gut der Krebs auf die Chemotherapie angesprochen hat.
Quelle: Axel Weber, Sylvia Taube, Sven Starke, Eckhard Bergmann, Nina Merete Christiansen, and Holger Christiansen: Detection of human tumor cells by amplicon fusion site polymerase chain reaction (AFS-PCR). In: J Clin Invest. 2011;121(2):545–553. doi:10.1172/JCI44415
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.uniklinik-leipzig.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie
Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.
Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.
Neueste Beiträge
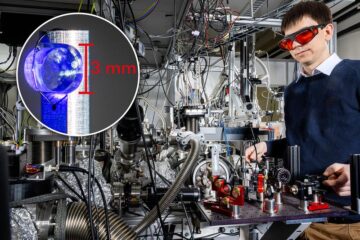
Atomkern mit Laserlicht angeregt
Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt
Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern
Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…





















