Dr. Eleftherios Goulielmakis erhält „Starting Grant“ des Europäischen Forschungsrats

Dieses Förderprogramm wurde vom Europäischen Forschungsrat mit dem Ziel etabliert, jungen Wissenschaftlern, die bereits ihre herausragenden Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben, die Mittel für eigene größere Projekte zu geben. Damit unterstützt dieses Programm die Bildung neuer exzellenter Forschungsteams.
Dr. Eleftherios Goulielmakis wurde 1975 in Heraklion (Griechenland) geboren.
Er studierte Physik an der Universität Kreta (Griechenland), an der er in den Jahren 2000 bzw. 2002 den Bachelor- und den Master-Abschluss bekam. Im Jahr 2005 promovierte er in Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Gegenwärtig arbeitet er als Wissenschaftler in der Abteilung für Attosekundenphysik von Prof. Ferenc Krausz am MPQ. Er ist sowohl einer der Projektleiter am „Munich-Centre for Advanced Photonics (MAP)” als auch assoziierter Professor für Physik an der Pohang University of Science and Technology (POSTECH) in Südkorea. 2007 wurde er mit dem Foteinos Preis der Akademie von Athen ausgezeichnet.
Der Forschungsschwerpunkt von Dr. Goulielmakis ist die Physik ultraschneller Prozesse. Insbesondere beschäftigt er sich mit der Entwicklung und der Anwendung von präzise kontrollierten Lichtpulsen in einem weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, vom Infraroten bis zum Röntgenlicht. Diese Lichtpulse ermöglichen Einblicke in fundamentale, in Atomen und Molekülen ablaufende Prozesse mit einer Auflösung, die gewissermaßen „Schnappschüsse“ von der extrem schnellen Bewegung der Elektronen erlaubt. Die Elektronenbewegung gehört zu den schnellsten Vorgängen im Mikrokosmos und bestimmt die fundamentalen Eigenschaften der Materie. Ihre Beobachtung ermöglicht nicht nur Einblicke in atomare und molekulare Prozesse, sondern ist auch die Grundlage für technologische Fortschritte.
Das jetzt mit dem ERC Grant geförderte Projekt „Attoelectronics“ beinhaltet die Entwicklung ultraschneller Lichttechniken, um die Bewegung von Elektronen in Atomen und Molekülen auf der Attosekundenskala zu verfolgen und zu steuern. Das ist die Voraussetzung dafür, mit nanoskaliger Elektronik Schaltungen zu verwirklichen, die tausendmal schneller als bisherige Anwender-Hardware sind. Olivia Meyer-Streng
Kontakt:
Dr. Eleftherios Goulielmakis
Max-Planck-Institut für Quantenoptik
Laboratory for Attosecond Physics
Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Tel: +49 89 32 905-632
Fax:+49 89 32 905-200
E-Mail: Eleftherios.Goulielmakis@mpq.mpg.de
Dr. Olivia Meyer-Streng
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik
Tel.: +49 – 89 / 32905 – 213
E-Mail: olivia.meyer-streng@mpq.mpg.de
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.mpq.mpg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Förderungen Preise
Neueste Beiträge
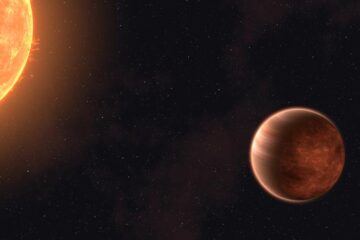
Wolken bedecken die Nachtseite des heißen Exoplaneten WASP-43b
Ein Forschungsteam, darunter Forschende des MPIA, hat mit Hilfe des Weltraumteleskops James Webb eine Temperaturkarte des heißen Gasriesen-Exoplaneten WASP-43b erstellt. Der nahe gelegene Mutterstern beleuchtet ständig eine Hälfte des Planeten…
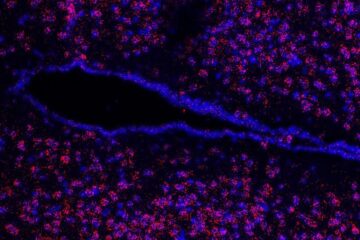
Neuer Regulator des Essverhaltens identifiziert
Möglicher Ansatz zur Behandlung von Übergewicht… Die rapide ansteigende Zahl von Personen mit Übergewicht oder Adipositas stellt weltweit ein gravierendes medizinisches Problem dar. Neben dem sich verändernden Lebensstil der Menschen…

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser
Ein Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der Extreme Light Infrastructure (ELI) hat gemeinsam ein Experiment zur Optimierung…





















