Wenn Berlin eine City-Maut bekäme

„Umso problematischer empfinden die Menschen etwa Kapazitätsengpässe, Verspätungen, mangelnde Information oder ungenügende Sicherheitsstandards“, sagt Barbara Lenz, TU-Professorin für Verkehrsnach-frage und Verkehrswirkungen und Leiterin des Berliner Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dort untersuchen sie und ihr Team Ursachen und Veränderungen des Personen- und Wirtschaftsverkehrs sowohl auf lokaler wie auf nationaler Ebene. Unter anderem beschäftigen sie sich damit, Aussagen darüber zu treffen, ob und wie politische Maßnahmen, veränderte Rahmenbedingungen wie explodierende Benzinpreise oder neue Technologien die Nachfrage nach Verkehrsleistungen verändern. Die Frage, der Barbara Lenz nachgeht, ist einfach formuliert: „Was passiert, wenn …?“; die Antwort darauf jedoch nicht so leicht gefunden. Riesige Datenmengen sind klug zu verknüpfen, die Arbeiten von Mathematikern, Informatikern, Soziologen und Ökonomen perfekt aufeinander abzustimmen. Eine enorme wissenschaftliche Herausforderung also.
„MILES – Mittel- und langfristige Entwicklung der Personenverkehrsnachfrage“ ist ein solches Projekt, das Antworten geben will auf jene Frage, was passiert, wenn … . Berlin mit seiner Bevölkerung, seinen rund 1,3 Millionen Autos und seinem öffentlichen Verkehrssystem dient dem Team von Barbara Lenz dabei als konkreter Raum, für den verschiedene Verkehrsszenarien dargestellt werden sollen.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten mit einem soge-nannten mikroskopisch-agentenbasierten Modell. In diesem werden einzelne Personen und ihre individuellen Lebenssituationen – Single oder verheiratet, jung oder alt, Autofahrer oder nicht – abgebildet. Außerdem sind in dem Modell bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben wie zum Beispiel der Preis für ein S-Bahn-Ticket oder die benötigte Zeit, um mit dem Auto von A nach B zu kommen.
Barbara Lenz erläutert: „Vor dem Hintergrund der persönlichen Situation, der beschriebenen Rahmenbedingungen und notwendigen Aktivitäten, wie etwa zur Arbeit zu fahren, bewegt sich diese Person durch Berlin. Verändern wir eine äußere Rahmenbedingung, indem wir etwa für Berlins Innenstadt die Einführung einer City-Maut simulieren, verändert sich auch die Entscheidungsgrundlage für jede Person. Diese muss sich nun entscheiden, ob sie ihr Verhalten ändert oder nicht und wenn ja, wie.
Indem wir jede Person und deren Entscheidungen im Modell abbilden, können wir schließlich die Folgen für den Verkehr aufzeigen.“ Um simulieren zu können, wie sich Menschen entscheiden, nutzen und erstellen die Forscherinnen und Forscher Analysen zum Verkehrsverhalten von Menschen, zum Beispiel bei Preisveränderungen, und speisen diese Daten in das Modell ein.
Eines der ersten Ergebnisse ist, dass eine City-Maut in Berlin eine deutlich reduzierte Zahl von Pkw-Fahrten von rund zehn Prozent ergeben könnte. Zu bedenken sei allerdings, dass die verbleibenden Fahrten teilweise länger würden, weil die Menschen weiter entfernte Ziele außerhalb der Mautzone wählten.
Weitere Informationen erteilt Ihnen gern: Prof. Dr. Barbara Lenz, Institut für Land- und Seeverkehr an der TU Berlin, Fachgebiet Verkehrsnachfrage und Verkehrswirkungen, Tel.: 030/67055-206, E-Mail: barbara.lenz@dlr.de
Weiterführende Links zum Thema Verkehr und Verkehrsforschung:
www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-582/
www.dlr.de/vf/
www.vsp.tu-berlin.de/
www.strassenplanung.tu-berlin.de/index_de.php
www.verkehrsplanung.tu-berlin.de/html/
Fotomaterial zum Download
www.tu-berlin.de/presse/pi/2007/…
Die Medieninformation zum Download:
www.pressestelle.tu-berlin.de/medieninformationen/
Hinweis: Dieser Beitrag ist das „Thema der Woche – EIN-Blick für Journalisten“ auf dem TUB-newsportal. Hier finden Sie zahlreiche Berichte aus der Forschung der TU Berlin: www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal
Weitere Informationen:
http://www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal
http://www.pressestelle.tu-berlin.de/medieninformationen/
http://www.tu-berlin.de/presse/pi/2007/…
http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-582/
http://www.dlr.de/vf/
http://www.vsp.tu-berlin.de/
http://www.strassenplanung.tu-berlin.de/index_de.php
http://www.verkehrsplanung.tu-berlin.de/html/
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.tu-berlin.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Verkehr Logistik
Von allen Aktivitäten zur physischen Raum- und Zeitüberbrückung von Gütern und Personen, einschließlich deren Umgruppierung – beginnend beim Lieferanten, durch die betrieblichen Wertschöpfungsstufen, bis zur Auslieferung der Produkte beim Kunden, inklusive der Abfallentsorgung und des Recyclings.
Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Verkehrstelematik, Maut, Verkehrsmanagementsysteme, Routenplanung, Transrapid, Verkehrsinfrastruktur, Flugsicherheit, Transporttechnik, Transportlogistik, Produktionslogistik und Mobilität.
Neueste Beiträge
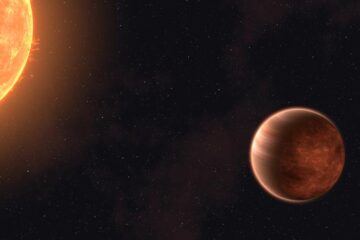
Wolken bedecken die Nachtseite des heißen Exoplaneten WASP-43b
Ein Forschungsteam, darunter Forschende des MPIA, hat mit Hilfe des Weltraumteleskops James Webb eine Temperaturkarte des heißen Gasriesen-Exoplaneten WASP-43b erstellt. Der nahe gelegene Mutterstern beleuchtet ständig eine Hälfte des Planeten…
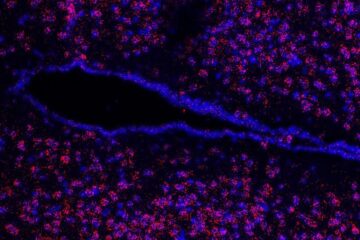
Neuer Regulator des Essverhaltens identifiziert
Möglicher Ansatz zur Behandlung von Übergewicht… Die rapide ansteigende Zahl von Personen mit Übergewicht oder Adipositas stellt weltweit ein gravierendes medizinisches Problem dar. Neben dem sich verändernden Lebensstil der Menschen…

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser
Ein Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der Extreme Light Infrastructure (ELI) hat gemeinsam ein Experiment zur Optimierung…





















