Die genetische Vielfalt macht’s: Erfolgsgeheimnis der Kalkalge Emilia huxleyi entschlüsselt

Emiliania huxleyi<br>Rastermikroskopische Aufnahmen der Kalkalge Emiliania huxleyi. Foto: Gerald Langer, Alfred-Wegener-Institut<br>
Das Genom der Kalkalge Emiliana huxleyi ist entschlüsselt und das Geheimnis eines Anpassungskünstlers gelüftet. Die Einzeller gedeihen in den Ozeanen vom Äquator bis zur subpolaren Zone, denn sie sind genetisch sehr flexibel. Sie teilen einen gewissen Stammsatz identischer Erbinformationen; der Rest des Genpools variiert stark und hängt von den jeweiligen Lebensbedingungen der Algen ab.
„Das kennen wir sonst nur von Bakterien“, sagen der Bioinformatiker Dr. Christoph Mayer vom Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn und der Biologe Dr. Florian Leese von der Ruhr-Universität Bochum. Beide Forscher fanden heraus, dass die Alge „Ehux“ eine ungewöhnlich hohe Menge an sich wiederholenden DNA-Sequenzen besitzt. Zusammen mit einem 75-köpfigen internationalem Team um Prof. Betsy Read von der California State University San Marcos berichten sie über ihre Ergebnisse und das Genome von Emiliana huxleyi in „Nature“.
Ohne „Ehux“ wie Emiliania huxleyi von Wissenschaftern liebevoll genannt wird, wäre es vermutlich auch deutlich wärmer auf der Erde. „Die kalkbildenden Mikroalgen wirken dem Klimawandel entgegen. Auf Langzeitskalen betrachtet, entziehen sie durch ihre Photosynthese und beim Bau ihrer Kalkschuppen der Atmosphäre erhebliche Mengen Kohlenstoff und binden diesen“, sagt der Biologe und Mitautor der Studie Dr. Uwe John vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).
Viel Wiederholung im Genom
Es gibt zwei Arten von repetitiver DNA: „Tandem Repeats“, DNA-Abschnitte mit gleicher Sequenz, die direkt hintereinander liegen, und „Interspersed Repeats“, die im Erbgut verstreut auftauchen. Mayer, der heute am Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn arbeitet, entwickelte eine neue Software, die „Tandem Repeats“ im Erbgut aufspürt. Damit fanden die Forscher heraus, dass mehr als ein Drittel der „Ehux“-DNA aus „Tandem Repeats“ bestehen; in anderen Einzellern sind es nur wenige Prozent. Man geht davon aus, dass sich das Erbgut mit Hilfe dieser repetitiven Abschnitte sehr schnell verändern kann. Mit Kollegen aus Frankreich bestimmten die Forscher aus Bonn und Bochum auch die Menge der „Interspersed Repeats“, deren Funktion bislang vollständig unbekannt ist. Sie machen bei Emiliana huxleyi ebenfalls etwa ein Drittel der DNA aus. In anderen Einzellern sind es in der Regel unter 10 Prozent.
Zum Organismus Emiliana huxleyi
Emiliania huxleyi ist eine einzellige Mikroalge mit einen Durchmesser von einem fünf- bis zehntausendstel Millimeter, also achtmal kleiner als der Durchmesser eines menschliches Haares. Sie kommt in allen Ozeanen der Welt vor, mit Ausnahme der sehr kalten Polarmeere. Die Alge tritt vor allem zur Blütezeit im Frühling und Sommer in sehr großen Mengen auf und bildet in dieser Zeit einen wesentlichen Teil des Meeresplanktons. Die kalkbildenen Mikroalgen wirken dem Klimawandel entgegen, indem sie beim Bau ihrer Kalkschuppen der Atmosphäre erhebliche Mengen Kohlenstoff entziehen und diesen binden.
Qelle: Die Studie ist unter folgendem Originaltitel im Online-Portal des Fachmagazins Nature erschienen:
Betsy A. Read et al: Pan genome of the phytoplankton Emiliania drives its global distribution, Nature: DOI: 10.1038/nature12221
Druckbare Fotos finden Sie in der Onlineausgabe dieser Pressemeldung des AWIs unter: http://www.awi.de/de/aktuelles_und_presse/pressemitteilungen/
Ansprechpartner:
Dr. Christoph Mayer, Forschungsmuseum Alexander Koenig, Adenauerallee 160, 53113 Bonn, Tel. 0228/9122403, E-Mail: c.mayer@zfmk.de
Die Stiftung Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere hat einen Forschungsanteil von mehr als 75 %. Das ZFMK betreibt sammlungsbasierte Biodiversitätsforschung zur Systematik und Phylogenie, Biogeographie und Taxonomie der terrestrischen Fauna. Die Ausstellung „Unser blauer Planet“ trägt zum Verständnis von Biodiversität unter globalen Aspekten bei.
Zur Leibniz-Gemeinschaft gehören zurzeit 86 Forschungsinstitute und wissenschaftliche Infrastruktureinrichtungen für die Forschung sowie drei assoziierte Mitglieder. Die Ausrichtung der Leibniz-Institute reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Sozial- und Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. Leibniz-Institute arbeiten strategisch und themenorientiert an Fragestellungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung Bund und Länder fördern die Institute der Leibniz-Gemeinschaft daher gemeinsam. Näheres unter www.leibniz-gemeinschaft.de
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.zfmk.de http://www.awi.de/de/aktuelles_und_presse/pressemitteilungen/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie
Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.
Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.
Neueste Beiträge

FDmiX: Schnelle und robuste Serienproduktion von Nanopartikeln
Verkapselungstechnologie der nächsten Generation… Nukleinsäure-basierte Medikamente wie mRNA-Impfstoffe bieten ein enormes Potenzial für die Medizin und eröffnen neue Therapieansätze. Damit diese Wirkstoffe gezielt in die Körperzellen transportiert werden können, müssen…

Sensor misst Sauerstoffgehalt in der Atemluft
Eine zu geringe oder zu hohe Sauerstoffsättigung im Blut kann bleibende körperliche Schäden bewirken und sogar zum Tod führen. In der Intensiv- und Unfallmedizin wird die Sauerstoffkonzentration der Patientinnen und…
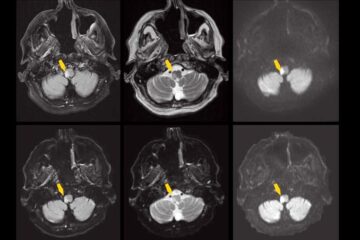
Neue MRT-Technik erkennt Schlaganfälle in kürzester Zeit
Tag gegen den Schlaganfall: Forschende der Universitätsmedizin Mainz haben im Rahmen einer Studie erstmals eine KI-gestützte Magnetresonanz-Tomographie (MRT)-Methode untersucht, um akute ischämische Schlaganfälle effizienter detektieren zu können. Dabei setzten sie…





















