Die Struktur macht den Werkstoff
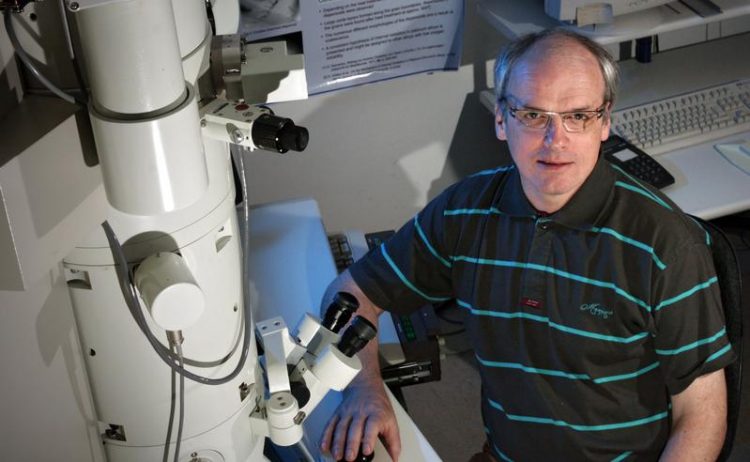
Materialwissenschaftler Prof. Dr. Dr. h. c. Markus Rettenmayr von der Uni Jena. Foto: Jan-Peter Kasper/FSU
Prof. Dr. Dr. h. c. Markus Rettenmayr von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgewählt worden, das Konzept zu einer Nachwuchsakademie auszuarbeiten, welches nach fachlicher Begutachtung nun umgesetzt wird.
Mit den Nachwuchsakademien fördert die DFG strategisch wichtige Schwerpunkte in der deutschen Forschungslandschaft. Der Jenaer Materialforscher wird die Nachwuchsakademie zum Thema „Thermodynamik und Kinetik in mehrkomponentigen metallischen und keramischen Werkstoffen“ gemeinsam mit seinem Fachkollegen Prof. Dr. Rainer Schmid-Fetzer von der TU Clausthal-Zellerfeld koordinieren.
Ziel der insgesamt erst siebten Nachwuchsakademie der DFG ist es, jungen Forschern aus ganz Deutschland bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Laufbahn Erfahrungen mit einem eigenen DFG-Projekt zu ermöglichen und gleichzeitig ein Themengebiet mit großem Forschungsbedarf mit kompetenten Nachwuchskräften zu verstärken.
Im Rahmen der Akademie werden bis zu zwanzig Nachwuchswissenschaftler ein eigenes Forschungsprojekt entwickeln. „Inhaltlich soll es vor allem um die Frage gehen, wie sich die Eigenschaften von kristallinen Werkstoffen aus unterschiedlichen Grundbestandteilen bestimmen und vorhersagen lassen, was die Werkstoffentwicklung wesentlich effizienter machen kann“, erläutert Prof. Rettenmayr.
Dabei, so macht der Inhaber des Jenaer Lehrstuhls für metallische Werkstoffe deutlich, spielen vor allem die Strukturen im Werkstoff eine entscheidende Rolle. „Denn die Eigenschaften eines Werkstoffs werden weniger von seiner chemischen Zusammensetzung als vielmehr von dem Gefüge bestimmt, das sich im Herstellungsprozess ausbildet.“
Um Werkstoffe für verschiedene Anwendungen entwickeln zu können, sei eine möglichst präzise Vorhersage ihrer Eigenschaften im Vorfeld wichtig, erläutert Rettenmayr. Ein Ziel der Nachwuchsakademie ist es daher, ein Instrumentarium an Methoden und Datenbanken zu entwickeln, die solche Vorhersagen ermöglichen.
Für die Nachwuchsakademie „Thermodynamik und Kinetik“ können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Ingenieur- oder Naturwissenschaften bewerben, die derzeit in der Endphase ihrer Promotion arbeiten oder deren Promotion nicht länger als vier Jahre zurückliegt. Mit der Bewerbung sind eine eigene Projektidee und eine Grundkonzeption des Forschungsvorhabens einzureichen.
Aus den Bewerbungen werden die Teilnehmer ausgewählt, die sich dann im Juni zur fünftägigen Akademie mit Fachleuten treffen und in Vorträgen, Seminaren und Einzelgesprächen ihre Forschungsideen diskutieren und weiterentwickeln. Aus den Projektskizzen sollen schließlich Förderanträge an die DFG gestellt werden, über die im kommenden Jahr entschieden wird. Eine Bewerbung ist bis zum 31. März möglich.
Weitere Informationen zur Nachwuchsakademie und den Bewerbungsmodalitäten sind zu finden unter: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_15_07/index.html.
Kontakt:
Prof. Dr. Dr. h. c. Markus Rettenmayr
Otto-Schott-Institut für Materialforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Löbdergraben 32, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 947790
E-Mail: m.rettenmayr[at]uni-jena.de
Media Contact
Alle Nachrichten aus der Kategorie: Bildung Wissenschaft
Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose
Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott
Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient
Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…





















