Frankfurter Supercomputer demonstriert seine Leistungsfähigkeit am CERN LHC

Am Nikolaustag endete im europäischen Kernforschungszentrum CERN die einmonatige Meßkampagne mit schweren Ionen aus Blei. Dabei wurden nicht nur Ionen auf Rekord-Energien beschleunigt.
Auch ein Hochleistungscomputer der Goethe-Universität, der für das Experiment gebaut wurde, hat im Dauerbetrieb seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt: Mit seiner Hilfe gelang es im Rahmen des Experiments ALICE (A Large Ion Collider Experiment), innerhalb weniger Tausendstelsekunden den Informationsgehalt von mehr als tausend Spuren nach den Kollisionen zu analysieren, das Experiment zu überwachen und bei der Auslese von für die Forscher interessanten Ereignissen zu unterstützen.
Die Daten des ALICE-Experiments werden mit Hilfe des High Level Triggers in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz International Center for FAIR (HIC for FAIR) schneller analysiert als dies bisher anderswo möglich ist.
Der High Level Trigger (HLT) ist ein Spezialrechner, der von Prof. Volker Lindenstruth von der Goethe-Universität eigens mit einer neuartigen Hochleistungs-Computer-Struktur entwickelt wurde. Hierbei werden auch Graphikkarten, die in handelsüblichen PCs zu finden sind, eingesetzt, um die höchsten Rechengeschwindigkeiten zu erreichen. Dadurch arbeitet der HLT einerseits mit der geforderten Höchstgeschwindigkeit und ist andererseits energieeffizient und zuverlässig. Diese Computerarchitektur ist auch Vorbild für den neuen Frankfurter Supercomputer LOEWE-CSC, der Ende November im Industriepark Höchst in Betrieb genommen wurde.
Die ersten Ergebnisse der neuartigen Blei-Experimente an CERN brachten gleich einen Weltrekord: Die bei einem zentralen Stoß umgesetzte Energie ist 15 Mal höher als die bisherige Bestmarke. Alle Komponenten des Experiments ALICE, das speziell für die Vermessung von Kollisionen von schweren Atomkernen konzipiert ist, funktionierten bei diesen Versuchen einwandfrei. In diesem Experimente wollen die Physiker für kurze Augenblicke den extrem heißen und dichten Plasmazustand der Materie aus Quarks und Gluonen wieder herstellen, wie er in den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall existiert hat. Im Herzen des Experiments zeichnet ein Detektor die Position Tausender geladener Teilchen auf, die bei der Kollision entstehen. Die darum herum gebaute Zeitprojektionskammer rekonstruiert die Teilchenbahnen wie eine dreidimensionale Kamera. An der Konstruktion dieses Detektors war die Frankfurter Arbeitsgruppe von Prof. Harald Appelshäuser am Institut für Kernphysik maßgeblich beteiligt, zusammen mit dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt sowie den Universitäten Darmstadt, Heidelberg und Münster sowie den Fachhochschulen Köln und Worms.
Informationen:
Prof. Volker Lindenstruth, Institut für Informatik und Institute for Advanced Studies (FIAS), Campus Riedberg, Tel. (069) 798-44101, 44101,
voli@fias.uni-frankfurt.de.
Prof. Harald Appelshäuser, Institut für Kernphysik, Campus Riedberg,
Tel.: (069) 798-40734; appels@ikf.uni-frankfurt.de.
Die Goethe-Universität ist eine forschungsstarke Hochschule in der europäischen Finanzmetropole Frankfurt. 1914 von Frankfurter Bürgern gegründet, ist sie heute eine der zehn drittmittelstärksten und größten Universitäten Deutschlands. Am 1. Januar 2008 gewann sie mit der Rückkehr zu ihren historischen Wurzeln als Stiftungsuniversität ein einzigartiges Maß an Eigenständigkeit. Parallel dazu erhält die Universität auch baulich ein neues Gesicht. Rund um das historische Poelzig-Ensemble im Frankfurter Westend entsteht ein neuer Campus, der ästhetische und funktionale Maßstäbe setzt. Die „Science City“ auf dem Riedberg vereint die naturwissenschaftlichen Fachbereiche in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei Max-Planck-Instituten. Mit über 55 Stiftungs- und Stiftungsgastprofessuren nimmt die Goethe-Universität laut Stifterverband eine Führungsrolle ein.
Herausgeber:
Der Präsident
Abteilung Marketing und Kommunikation,
Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Redaktion: Dr. Anne Hardy, Referentin für Wissenschaftskommunikation
Telefon (069) 798 – 2 92 28, Telefax (069) 798 – 2 85 30,
E-Mail hardy@pvw.uni-frankfurt.de
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.uni-frankfurt.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie
Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.
Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.
Neueste Beiträge
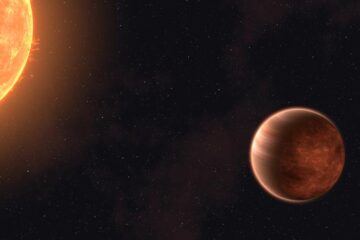
Wolken bedecken die Nachtseite des heißen Exoplaneten WASP-43b
Ein Forschungsteam, darunter Forschende des MPIA, hat mit Hilfe des Weltraumteleskops James Webb eine Temperaturkarte des heißen Gasriesen-Exoplaneten WASP-43b erstellt. Der nahe gelegene Mutterstern beleuchtet ständig eine Hälfte des Planeten…
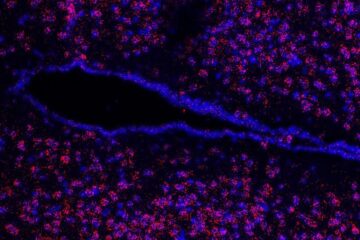
Neuer Regulator des Essverhaltens identifiziert
Möglicher Ansatz zur Behandlung von Übergewicht… Die rapide ansteigende Zahl von Personen mit Übergewicht oder Adipositas stellt weltweit ein gravierendes medizinisches Problem dar. Neben dem sich verändernden Lebensstil der Menschen…

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser
Ein Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der Extreme Light Infrastructure (ELI) hat gemeinsam ein Experiment zur Optimierung…





















