Röntgenblick enträtselt mysteriöse Verfärbung eines Van-Gogh-Gemäldes

Vincent van Gogh (1853-1890): "Blumen in blauer Vase" (KM 107.055), Öl auf Leinwand, 61,5 x 38,5 cm, circa Juni 1887.<br><br>Bild: Kröller-Müller-Museum<br>
Ein vermeintlich schützender Firnis, der nach dem Tod des Meisters auf das Bild „Blumen in blauer Vase“ aufgetragen wurde, hat demnach die Verfärbung einiger Blumen von einem leuchtenden Gelb zu einem matten Orange-Grau eingeleitet.
Verantwortlich ist ein zuvor unbekannter Zersetzungsprozess, den Untersuchungen an der DESY-Röntgenquelle PETRA III und an der Europäischen Synchrotronquelle ESRF im französischen Grenoble erstmals enthüllt haben, und der sich an der Grenze zwischen Farbe und Firnis abspielt.
Die internationale Forschergruppe berichtet in einer der kommenden Ausgaben des Fachblatts „Analytical Chemistry“ über ihre Untersuchungen. Erstautor ist Geert Van der Snickt von der Universität Antwerpen (Belgien), der mit dieser Arbeit seinen Doktortitel in Konservierung und Restaurierung erworben hat. Leiter des Forscherteams ist Koen Janssens aus Antwerpen, neben DESY und ESRF sind die Technische Universität Delft (Niederlande), die staatliche französische Forschungsorganisation CNRS sowie das niederländische Kröller-Müller-Museum an der Arbeit beteiligt.
Vincent Van Gogh (1853 – 1890) hatte die „Blumen in blauer Vase“ 1887 in Paris gemalt, seit Anfang des 20. Jahrhunderts befindet sich das Bild im Besitz des Kröller-Müller-Museums in Otterlo. Der Meister hat seine Werke normalerweise nicht mit einem Firnis versehen, auf das untersuchte Gemälde wurde nachträglich ein Firnis aufgetragen – wie auf eine Reihe anderer Van-Gogh-Gemälde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. „Bei der jüngsten Konservierungsbehandlung im Jahr 2009 zeigte sich eine ungewöhnliche, graue Kruste auf Bereichen mit Cadmiumgelb“, berichtet Konservatorin Margje Leeuwestein vom Kröller-Müller-Museum.
Van Gogh hatte für das Gemälde unter anderem das damals relativ neue Pigment Cadmiumgelb verwendet, chemisch Cadmiumsulfid (CdS). Später wurde entdeckt, dass Cadmiumgelb an der Luft seine Farbe verliert und die Pigmente ihre Leuchtkraft einbüßen. Schuld ist die Oxidation zu Cadmiumsulfat (CdSO4). „Wir haben diesen Prozess vor ein paar Jahren aufgeklärt, und die Beobachtung, dass die Pigmente hier mit einer dunklen, rissigen Kruste überzogen sind statt mit der leicht weißen, transparenten Oxidationsschicht, hat uns sehr neugierig gemacht“, berichtet Janssens. „Die Kruste und der verfärbte Firnis ließen sich nicht entfernen, ohne die sehr brüchige Cadmiumfarbe zu beeinträchtigen“, ergänzt Leeuwestein.
Um der Ursache auf den Grund zu gehen, schickte das Museum schließlich zwei mikroskopisch kleine Farbproben – beide nur Millimeterbruchteile groß – vom Originalgemälde zur Untersuchung an das Team von Janssens. Die Forscher durchleuchteten die Farbproben an der ESRF-Messstation ID21 und an der Messstation P06 an DESYs Röntgenquelle PETRA III und untersuchten die chemische Zusammensetzung sowie die innere Struktur an der Farb-Firnis-Grenze. Kristallines Cadmiumsulfat, das bei der Oxidation entstanden sein sollte, ließ sich dabei überraschenderweise nicht aufspüren. „Es zeigte sich, dass die Sulfat-Ionen aus dem Cadmiumsulfat mit Blei aus dem Firnis sogenanntes Bleivitriol gebildet hatten“, erläutert DESY-Forscher Gerald Falkenberg aus dem Team. Bleivitriol (PbSO4), eine opake Verbindung, fand sich in weiten Bereichen des Firnis. „Quelle des Bleis ist vermutlich ein bleihaltiges Trocknungsmittel, das dem Firnis beigemischt worden war“, sagt Falkenberg.
„An der Grenzschicht zwischen Farbe und Firnis bildete sich zudem mit Abbauprodukten aus dem Firnis eine Schicht aus Cadmiumoxalat“, ergänzt ESRF-Forscherin Marine Cotte. Gemeinsam mit dem Bleivitriol ist das Cadmiumoxalat (CdC2O4) für die undurchsichtige, orange-graue Kruste auf den cadmiumgelben Bereichen des Gemäldes verantwortlich.
„Die Erforschung dieses bislang unbekannten Zersetzungsprozesses erlaubt uns, besser zu verstehen, warum das Gemälde heute so aussieht“, betont Leeuwestein. Und Joris Dik von der TU Delft ergänzt: „Die Arbeit liefert außerdem Information darüber, wie nachträglich aufgetragene Firnis-Schichten zu einem Verfall bestimmter Pigmente eines Gemäldes beitragen können. Künftig lässt sich dieser Zerfallsprozess hoffentlich stoppen oder sogar mit neuen Konservierungstechniken verhindern.“ Ob eine Entfernung des Firnis auf dem untersuchten Gemälde möglich und sinnvoll ist, sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagt Leeuwestein. „Bei einer möglichen Entfernung von Firnis und Kruste muss man immer bedenken, dass Firnis und Kruste Originalmaterial des Cadmiumgelbs enthalten. Die mögliche Entfernung von Originalmaterial von einem Gemälde ist bei einer Konservierungsbehandlung natürlich unerwünscht.“
In vielen Museen werden Konservatoren sich nach dieser Veröffentlichung nun Fragen über die Restaurierung von Van-Gogh-Gemälden stellen. „Diese Studie zur Zersetzung von Cadmiumgelb ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Konservatoren helfen kann, den Zustand von Van Goghs Gemälden besser zu verstehen, und seine Werke besser zu bewahren“, sagt die Chef-Konservatorin des Van-Gogh-Museums in Amsterdam, Ella Hendriks, die an der Arbeit nicht beteiligt war. „Viele der Gemälde aus Van Goghs Französischer Periode sind in der Vergangenheit mit ungeeignetem Firnis versehen worden, und die Entfernung dieser nicht originalen Firnisschichten ist eine der Herausforderungen, denen Konservatoren weltweit heute gegenüberstehen. Janssens und sein Team haben entscheidende Informationen geliefert, um Konservatoren bei den schwierigen Entscheidungen über solche komplexen Reinigungsbehandlungen zu unterstützen.“
„Einmal mehr stellen wir fest, dass Gemälde von Vincent Van Gogh nicht unveränderlich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sind“, schließt Janssens. „Über einen Zeitraum von 100 Jahren sind sie ein ziemlich reaktiver Cocktail von Chemikalien, der sich überraschend verhält.“ Und Geert Van der Snickt fügt hinzu: „Besonders die Anwesenheit von Sulfiden gefährdet die Haltbarkeit der Gemälde.“ In den nächsten vier Jahren will Janssens´ Gruppe untersuchen, wie sich die Umgebungsbedingungen in Museen sowie die Luftverschmutzung auf Cadmiumgelb und andere sulfidhaltige Pigmente auswirken.
Originalstudie: “Combined use of synchrotron radiation-based µ-XRF, µ-XRD, µ-XANES and µ-FTIR reveals an alternative degradation pathway of the pigment cadmium yellow (CdS) in a painting by Van Gogh”; G. Van der Snickt et al.; “Analytical Chemistry” (online vorab, 2012); DOI: 10.1021/ac3015627
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Koen Janssens, koen.janssens@ua.ac.be, +32 474 46 55 32
Joris Dik, j.dik@tudelft.nl
Marine Cotte, marine.cotte@esrf.fr
Gerald Falkenberg, gerald.falkenberg@desy.de
Media Contact
Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie
Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.
Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.
Neueste Beiträge

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit
Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…
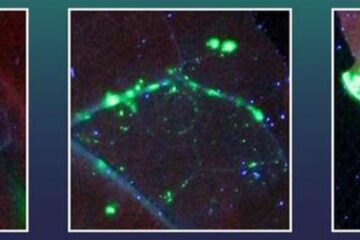
Durchbruch bei CRISPR/Cas
Optimierte Genschere erlaubt den stabilen Einbau von großen Genen. Großer Fortschritt an der CRISPR-Front. Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Pflanzenbiochemie (IPB) ist es erstmals gelungen, sehr effizient große Gen-Abschnitte stabil und…

Rittal TX Colo: Das neue Rack für Colocation Data Center
Rittal TX Colo: Flexibel, skalierbar und zukunftssicher Mit der zunehmenden Digitalisierung und künftig auch immer mehr KI-Anwendungen steigt der Bedarf an Rechenleistung signifikant – und damit boomt der Colocation-Markt. Unternehmen…





















