Weltsuizidpräventionstag 2007: Suizidprävention ist für alle Lebensphasen wichtig

Die Todesursache Suizid ist ein unterschätztes Problem. Weltweit nehmen sich jährlich etwa eine Million Menschen das Leben. In Deutschland versterben jährlich zirka 11.000 Menschen durch Selbsttötung. Dies übersteigt deutlich die Zahl der Verkehrstoten. Experten schätzen, dass Suizidversuche etwa zehn- bis zwanzigmal häufiger als Selbsttötungen vorkommen.
Ferner fällt an Suizidstatistiken auf, dass die Zahl der von Männern begangenen Selbsttötungen die der Frauen weit übersteigt. Auf eine bestimmte Lebensphase lässt sich das Phänomen der Selbsttötung nicht begrenzen. Zwar nimmt in fast allen Ländern der Erde das Suizidrisiko mit steigendem Lebensalter zu und ist bei den über 85-Jährigen am höchsten. Suizid kommt aber in allen Lebensphasen vor. Deshalb sind Präventionsmaßnahmen auf die unterschiedlichen Phasen des jungen, mittleren und hohen Lebensabschnitts auszurichten. Zu berücksichtigen sind insbesondere die für diese Phasen spezifischen Risikofaktoren und psychodynamischen Ursachen für suizidales Verhalten.
Das Frankfurter Universitätsklinikum versammelt im Vorfeld des Weltsuizidpräventionstages 2007 einen Expertenkreis, um unter Federführung der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (Direktor: Prof. Dr. Konrad Maurer) in der Öffentlichkeit über Suizidrisiken, aktuelle Präventionsmöglichkeiten sowie über Hilfen für Hinterbliebene zu informieren. Das Motto dieses weltweiten Informationstages, der am 10. September stattfindet, lautet „Suicide Prevention across the Life Span“. Die Internationale Vereinigung für Suizidprävention (IASP) nutzt diesen Infotag in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), um auf Suizide als Ursache für vorzeitige und verhinderbare Todesfälle aufmerksam zu machen.
Risikofaktoren für eine Suizidgefährdung: körperliche und psychische Erkrankungen
Deutschland hat die dritthöchste Zahl an Selbsttötungen in Europa mit fast 11.000 Suiziden im Jahr. Wissenschaftlich bewiesene Risikofaktoren für Suizid und suizidales Verhalten sind neben psychischen Erkrankungen auch körperliche Erkrankungen. Im Erwachsenenalter sind seelische Erkrankungen der bedeutendste Risikofaktor für Suizid, insbesondere Depressionen, Alkoholismus und der Gebrauch anderer Suchtmittel. Im globalen Zusammenhang sind Schizophrenie, Alkoholismus und Depression die drei Erkrankungen, die am häufigsten im Zusammenhang mit Suizid gefunden wurden. Für den internationalen Kontext wurde berechnet, dass die Behandlung dieser Erkrankungen die Suizidraten weltweit um ungefähr 20,5 Prozent von 15,1 pro 100.000 auf 12 pro 100.000 senken würde.*
Eine monokausale Identifikation von Suizidrisikofaktoren ist nicht zielführend. Denn Selbsttötung ist in der Regel auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Zudem unterscheiden sich die Risikokonstellationen und die quantitative Bedeutung der einzelnen Risikofaktoren in verschiedenen Populationen. Sie können je nach Land oder Region verschieden sein. Gestützt auf eine Auswertung von Fall-Kontrollstudien (unter Anwendung der psychologischen Autopsie, einer etablierten Methode zur Informationsgewinnung über Verstorbene) und Verlaufsstudien, identifizierte die Suizidforschung als Risikofaktoren – wie bereits erwähnt – psychische und körperliche Erkrankungen, die ein signifikant erhöhtes Suizidrisiko mit sich bringen, aber auch Aspekte der Lebenssituation wie Alleinleben und Partner- und Arbeitslosigkeit. Zu den psychischen Erkrankungen zählen Alkoholismus, die bipolare affektive Störung, insbesondere Depression, die anhaltende depressive Verstimmung (Dysthymie), Angsterkrankungen, Essstörungen und Persönlichkeitsstörungen. Körperliche Erkrankungen, mit denen ein erhöhtes Suizidrisiko einhergeht, sind unter anderem die dialysepflichtige Niereninsuffizienz, HIV-Infektionen, neurologische Erkrankungen und Krebserkrankungen, vor allem im Kopf- und Halsbereich.**
Eine der weltweit größten und die einzige in Deutschland durchgeführte Studie zur Untersuchung und Identifizierung von Risikofaktoren für Suizid von PD Dr. Barbara Schneider, Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Frankfurter Universitätsklinikum, unterstreicht die bisher bekannten Aspekte unter besonderer Berücksichtigung von Risikokonstellationen.
Stark erhöhtes Suizidrisiko bei Suchterkrankungen
Mediziner gehen vor allem bei Suchterkrankungen von einer starken Erhöhung des Suizidrisikos aus. Verlaufsuntersuchungen und kontrollierte psychologische Autopsiestudien aus den letzten Jahren ergaben, dass zwischen 19 und 63 Prozent aller Suizidopfer an Störungen durch den Konsum psychotroper Substanzen litten. „Es ist bekannt, dass sich Suchtkranke kaum während stationärer psychiatrischer Aufenthalte das Leben nehmen“, konstatiert Schneider, zudem auch Leiterin der Arbeitsgruppe Suchterkrankungen des Nationalen Suizid Präventionsprogramms (NASPRO) und Mitglied der „International Academy for Suicide Research“. „Wir müssen uns deshalb fragen, warum suizidale Suchtkranke das suizidpräventive Hilfssystem nicht in Anspruch nehmen“, so Schneider weiter. Umfragen bei den suizidpräventiven Hilfssystemen und bei Einrichtungen der Suchthilfe in Deutschland haben zudem ergeben, dass nie Daten über deren Inanspruchnahme durch Suizidale erhoben wurden.
Steigende Suizidraten bei alten Menschen
Die Suizidraten steigen mit dem Lebensalter. Männer über 75 Jahre nehmen sich mehr als doppelt so häufig das Leben wie gleichaltrige Frauen. Auch die Diskrepanz in den Suizidraten der alten gegenüber den jungen Menschen ist beträchtlich: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2005 versterben von den Männern über 90 Jahren mehr als 90 pro 100.000 durch Selbsttötung gegenüber knapp 20 pro 100.000 bei den männlichen 30-Jährigen. Etwa jeder vierte Mensch über 65 Jahre leidet an einer psychischen Erkrankung, berichtet das Nationale Suizidpräventionsprogramm (NASPRO).
Zu den häufigsten Erkrankungen bei dieser Gruppe gehören Depressionen, die mit den nicht mehr zu bewältigenden Veränderungen der Lebenssituation verbunden sind. Hierzu zählen der Verlust des Partners oder die Auflösung des sozialen Umfelds nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Typisch für eine Depression in diesem Alter ist das begleitende quälende Gefühl, nicht produktiv und deshalb nichts wert zu sein. Studien zu folge erhöhen schwere körperliche Krankheiten wie koronare Herzerkrankungen, die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, Anfallsleiden, Harninkontinenz, Schlaganfälle und Sehstörungen bei alten Menschen die Suizidgefahr. Dies gilt auch für chronisch schmerzhafte Erkrankungen des Bewegungsapparates. Sie verkürzen die Lebenserwartung nicht wesentlich, erhöhen aber die Suizidalität und können von Depressionen bestimmt sein. „Körperlich bedingte Erlebnisse des Autonomieverlusts und damit einhergehende potenzielle Kränkungen der menschlichen Existenz sind zentrale psychodynamische Faktoren für Suizidalität im Alter“, meint Professor Dr. Martin Teising, Spezialist für Gerontopsychiatrie am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt.
Krisenerkennung und -intervention: Mehr direkte Kommunikation mit den Betroffenen
Suizidale Krisen entstehen in seelischer Not, sie sind nicht als Akt einer freien Entscheidung zu sehen. Ihnen geht als Prozess in der Regel eine „Entstehungsgeschichte“ voraus, in die interveniert werden kann. Neben der medizinischen Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie wird deshalb verstärkt auf die notwendige Einbindung so genannter „Multiplikatoren“ verwiesen. Spezialisten aus dem Gesundheitssektor und Menschen aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Bildung, Arbeit, Recht, Religion, Politik und Medien arbeiten hier zusammen für eine größere Aufmerksamkeit. Eine größere Bereitschaft der Gesellschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Thema hilft, Stigmatisierung zu reduzieren und erleichtert nicht zuletzt Suizidgefährdeten, Hilfssysteme annehmen zu können.
Auf den dauerhaften Kontakt zu Menschen mit Depression setzt auch das Projekt PRoMPT (PRimary care Monitoring for depressive Patients' Trial) am Institut für Allgemeinmedizin, das Dr. Dipl.-Päd. Jochen Gensichen leitet. Das Projekt setzt auf die enge Kooperation des Patienten mit dem Hausarzt und seinem Praxisteam. Dabei fußt die Behandlung auf der kontinuierlichen Kommunikation des Patienten mit dem Praxisteam, indem der Patient telefonisch vom Praxisteam seines Arztes betreut und regelmäßig mit einem Fragebogen nach seinem akuten Befinden befragt wird. Der Gesundheitszustand kann daraufhin vom Arzt bewertet und eine Therapie entsprechend eingestellt werden. „Die Sterberate bei Depressiven ist im Vergleich zu Gleichaltrigen aus der Allgemeinbevölkerung etwa doppelt so hoch. Entsprechend wichtig sind Behandlungskonzepte, die eine kontinuierliche Betreuung depressiv kranker Menschen ermöglichen“, erklärt Gensichen.
Für weitere Informationen:
Prof. Dr. med. Konrad Maurer
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Klinikum der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Main
Fon (069) 6301 – 5125
Fax (069) 6301 – 5290
E-Mail konrad.maurer@em.uni-frankfurt.de
Internet www.kgu.de/zpsy/psychiatrie1/home/
PD Dr. Barbara Schneider
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Klinikum der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Main
Fon (069) 6301 – 47 84
Fax (069) 6301 – 5936
E-Mail b.schneider@em.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. Martin Teising
Fachbereich Pflege und Gesundheit
Gerontopsychiatrie/Psychotherapie
Fachhochschule Frankfurt
Fon (0 69) 15 33 – 2854
Fax (0 69) 15 33 – 28 57
E-Mail teising@fb4.fh-frankfurt.de
Media Contact
Weitere Informationen:
http://www.welttag-suizidpraevention.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Veranstaltungsnachrichten
Neueste Beiträge
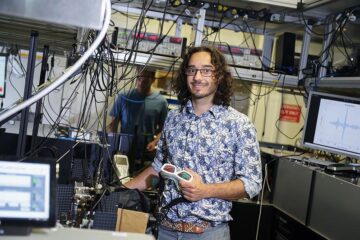
Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation
Ein internationales Forscherteam berichtet in Nature über eine neue Methode, mit der zum ersten Mal die Talpolarisation in zentrosymmetrischen Bulk-Materialien auf eine nicht materialspezifische Weise erreicht wird. Diese „universelle Technik“…

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus
Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit
Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…





















